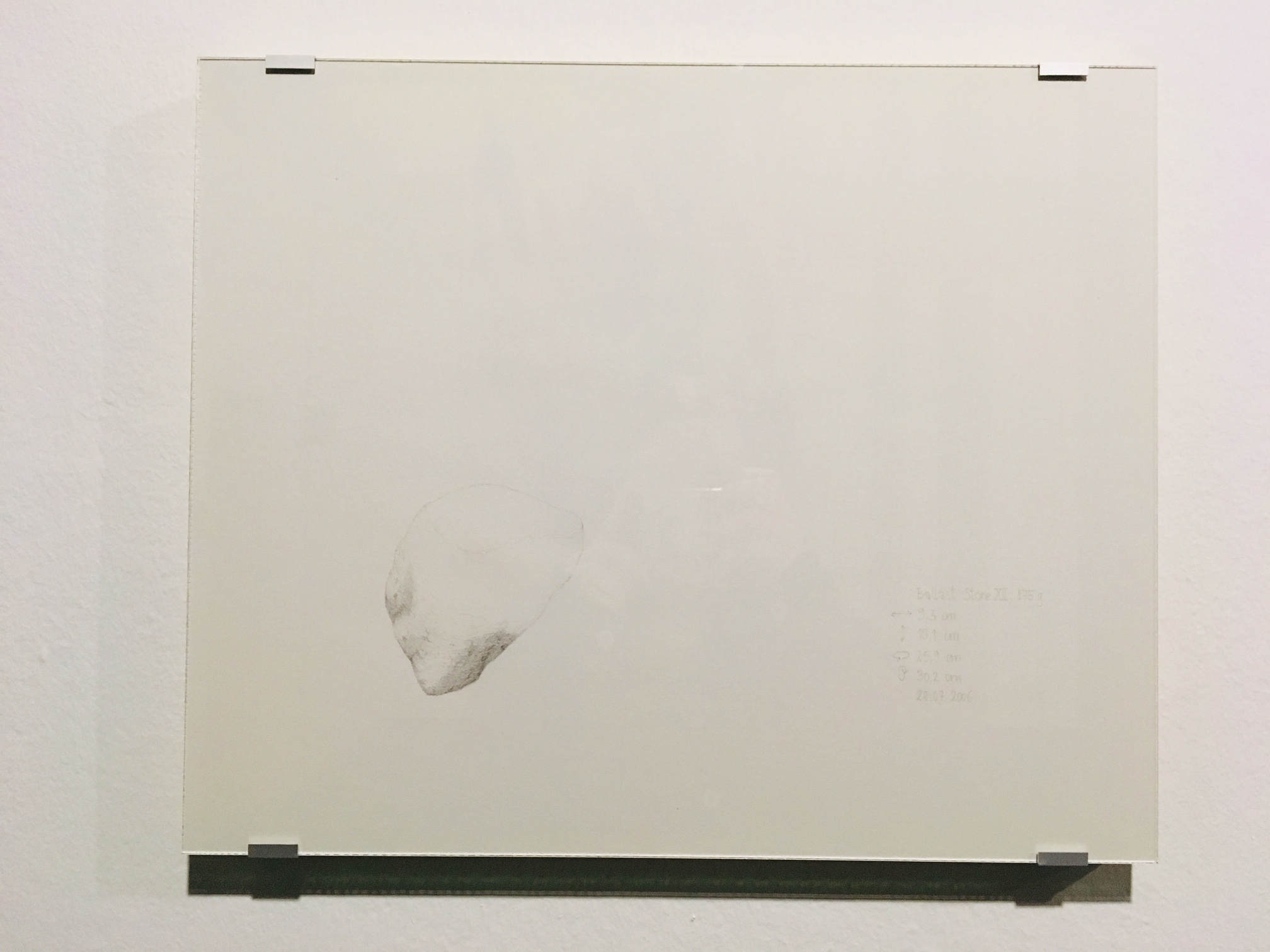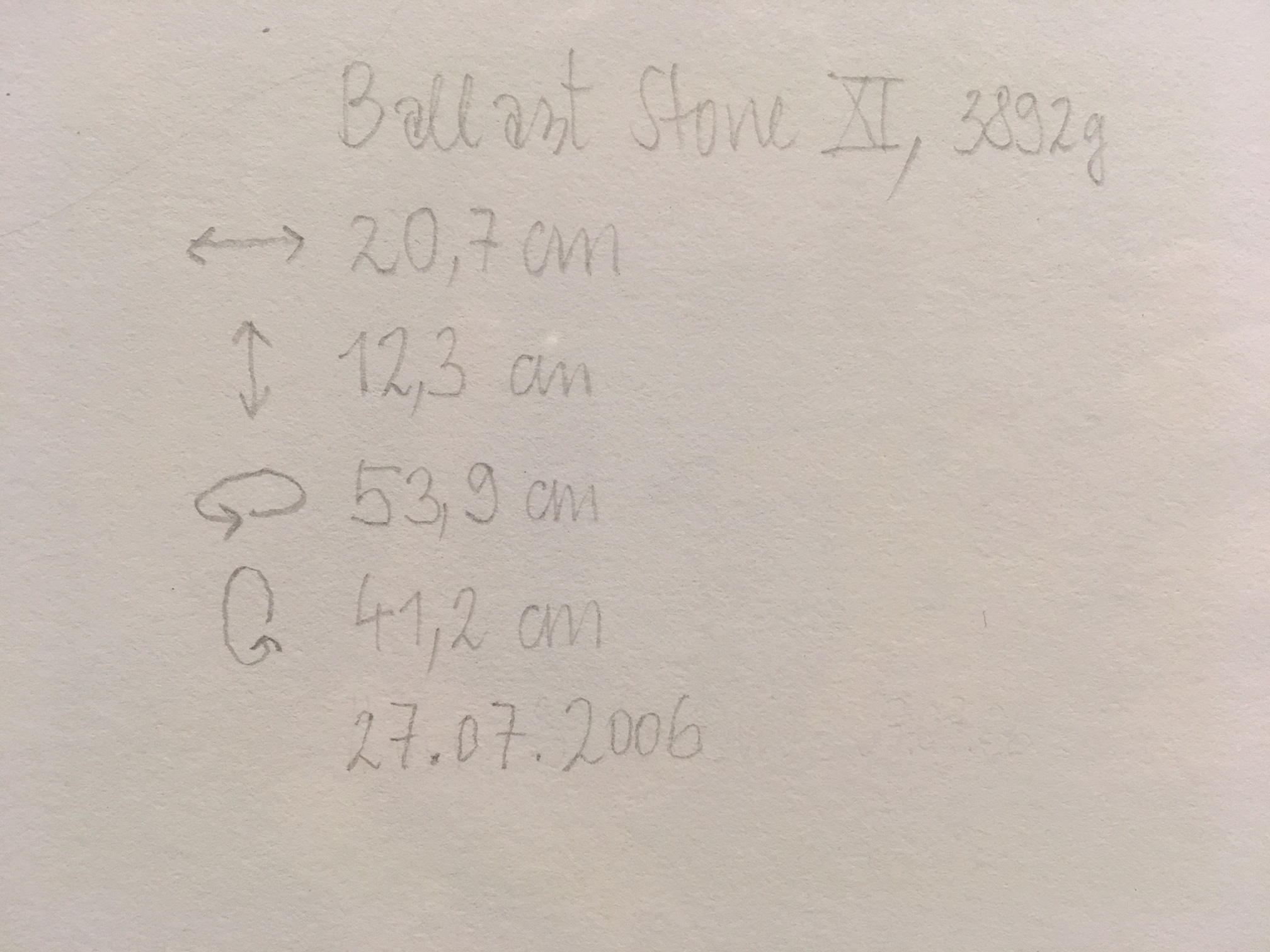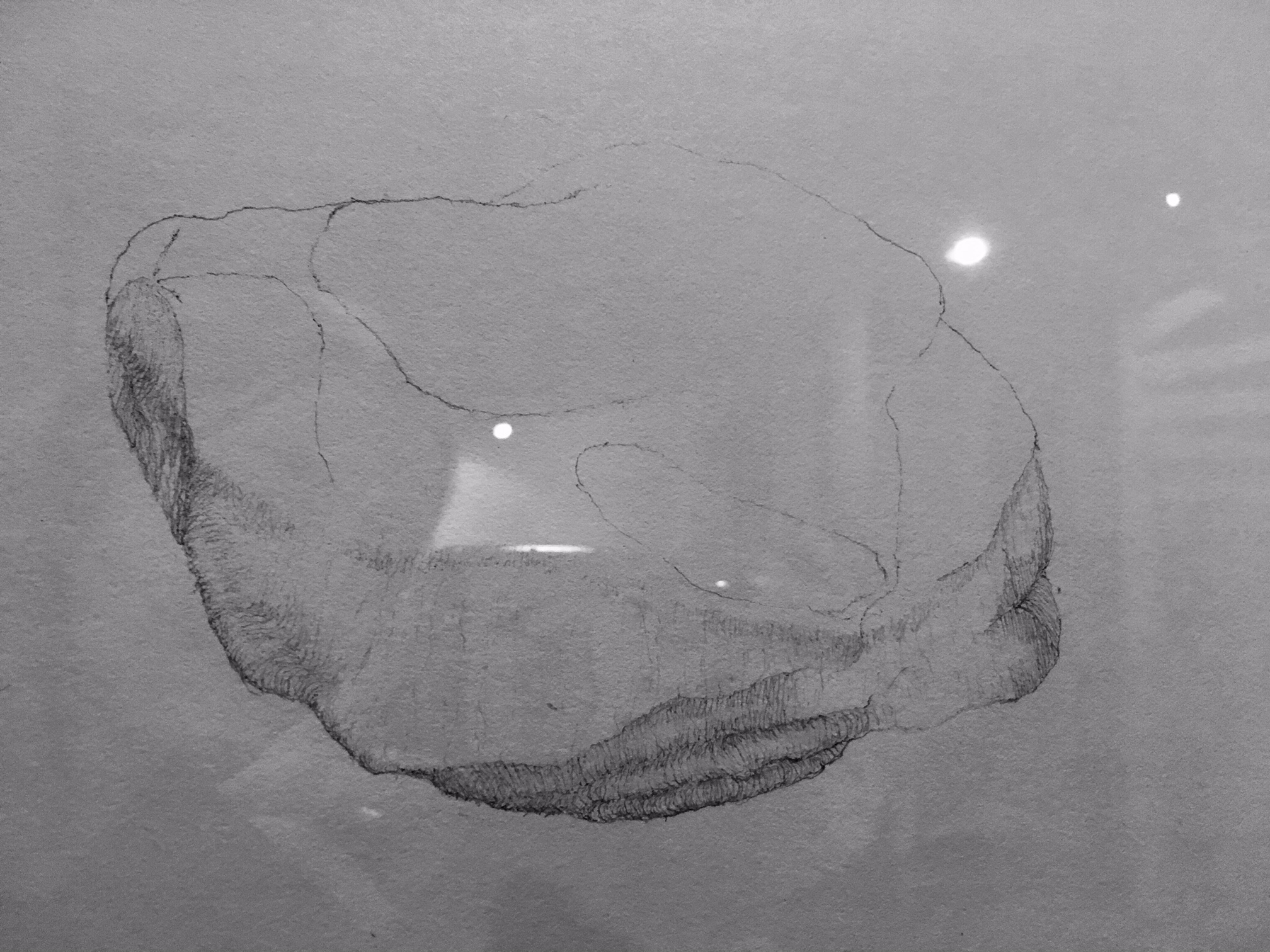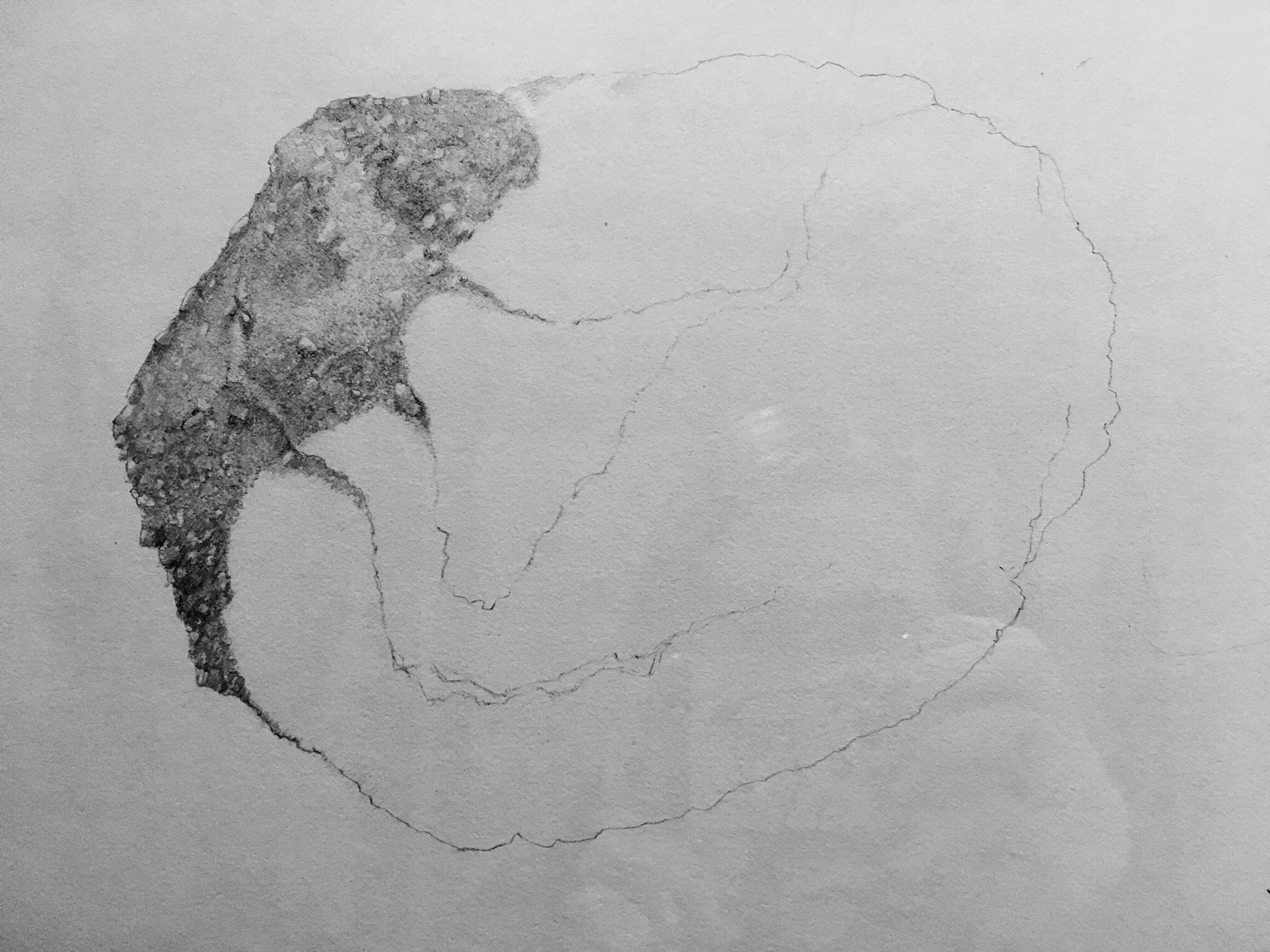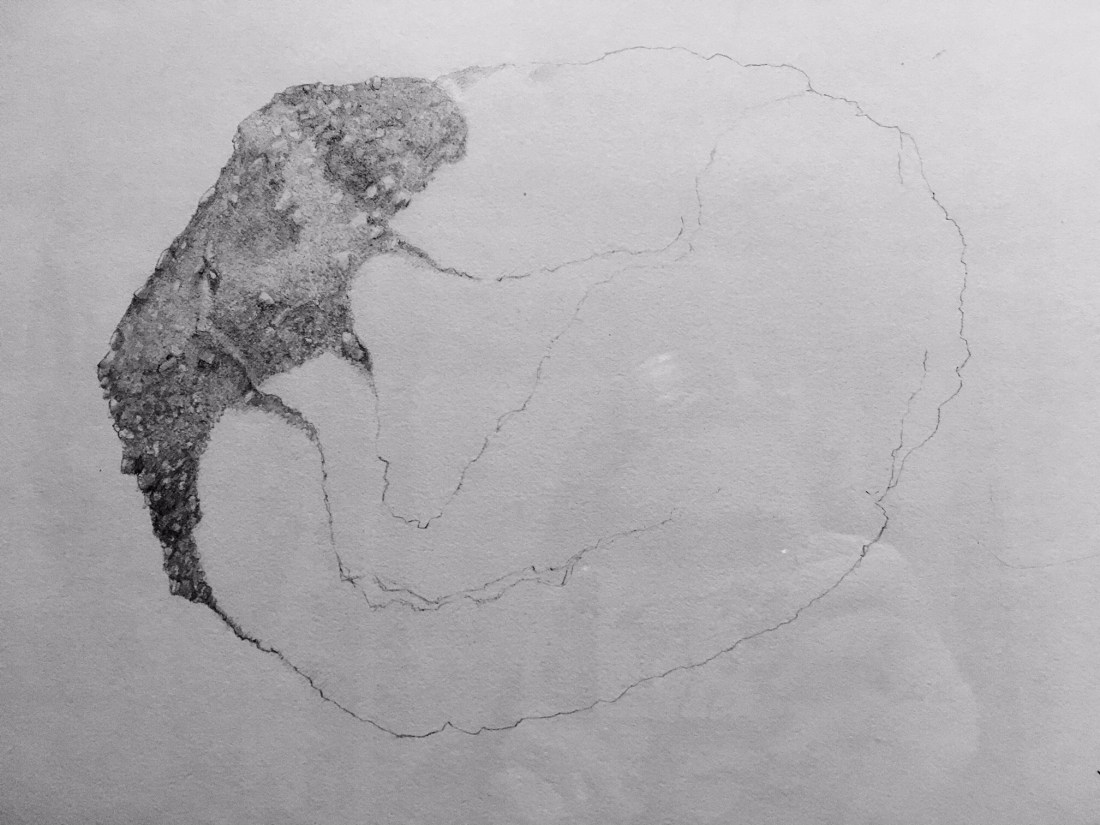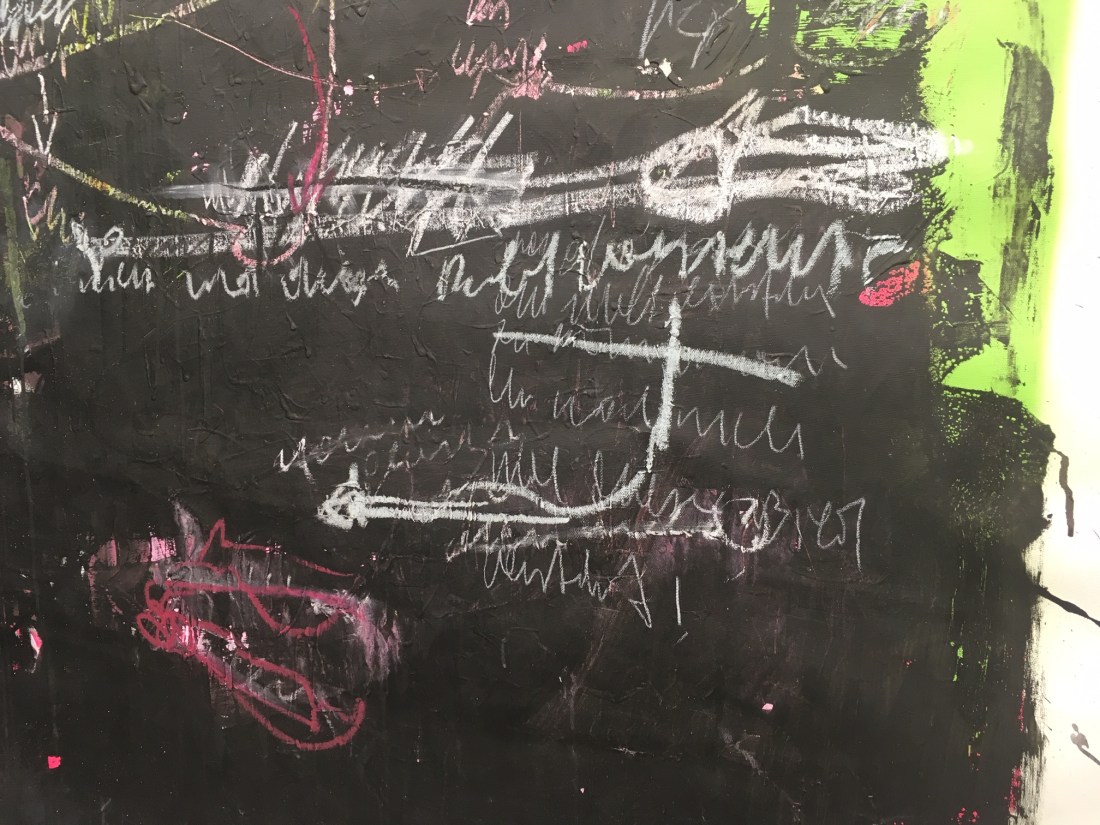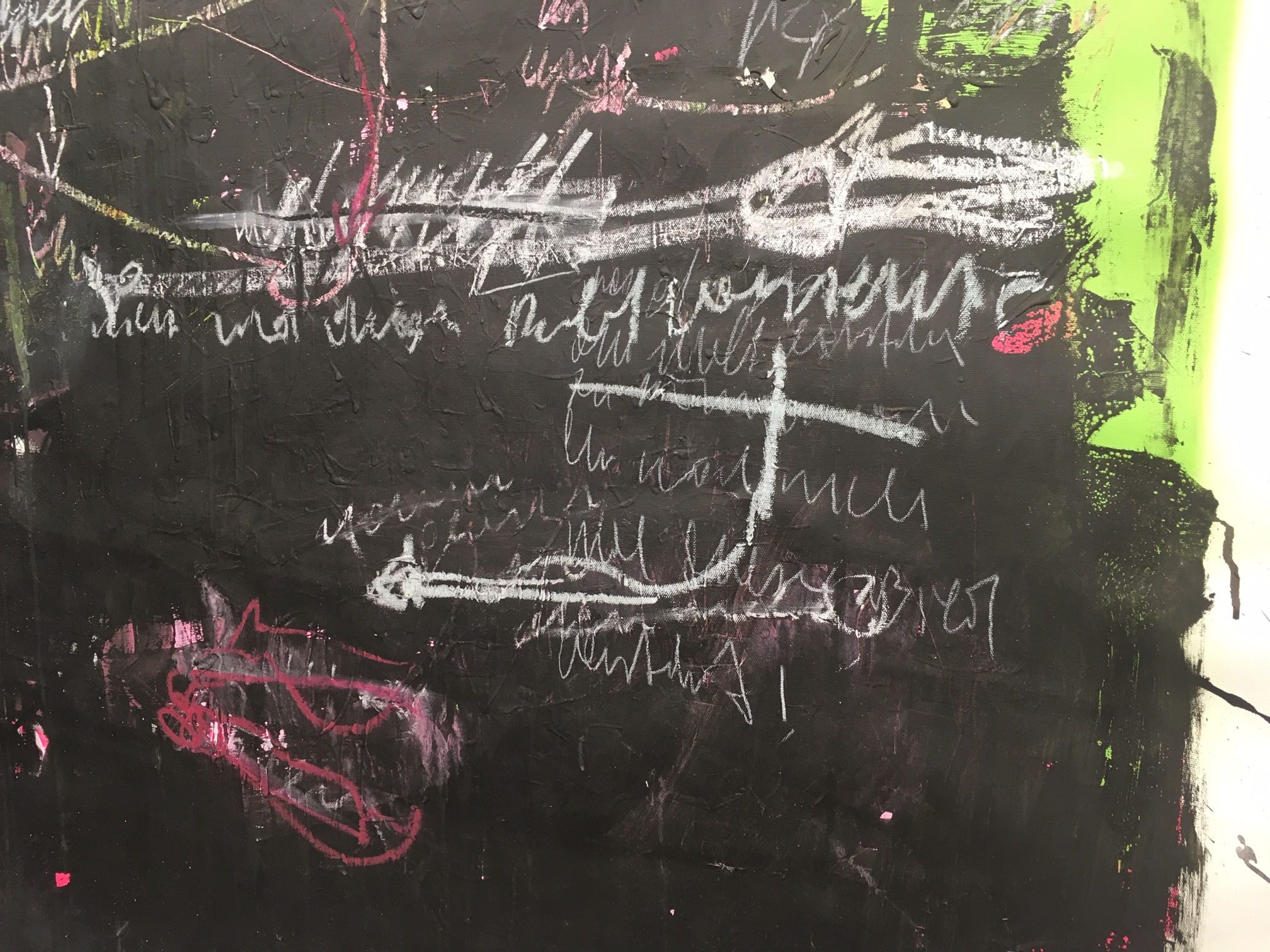Rückblick auf die Rauriser Literaturtage 2019. Die Rauriser Literaturtage gehen auch dieses Jahr zu Ende. Die Autoren reisen ab, die Studierenden fahren zu ihren Unis zurück, nur wir Salzburger bleiben, wo wir sind. Eine kurze Zusammenfassung meiner stärksten Eindrücke und Erfahrungen.
Am Mittwochabend beginnen die Literaturtage mit aberwitzigen Reden von Politkern, die für einen kurzen Moment daran zweifeln lassen, dass man sich tatsächlich in einer anspruchsvollen, literarischen Veranstaltung befindet. So gratuliert Landeshauptmann Haslauer dem Parteikollegen zu einem volksdemokratischen Wahlergebnis und spaßt, dass der Nordkoreanische Präsident bald anrufen und um Rat bitten würde. Die einführenden Worte der Intendanten Ines Schütz und Manfred Mittermayer sowie eine Lesung von Philipp Weiss, dem Hauptpreisträger (Am Weltenrand sitzen die Menschen und lachen) eröffnen dann aber das Literaturfestival, für das wir angereist sind. Die Eröffnungsworte des Intendantenteams sind überraschend politisch. So lautet eine Passage von Mittermayer: “Wir leben in einer Welt, in der viel in Bewegung geraten ist, in der sich ganz große Chancen auf Verbindungen mit anderen Ländern eröffnet haben. Es ist eine Herausforderung, aber wir müssen solidarisch bleiben.“ Eine Solidaritätserklärung, die die nächsten Tage in den Texten widerhallen wird. „Auf.Brüche“ lautet das Thema des diesjährigen Festivals. In den kommenden Tagen sehen wir uns berührenden Lesungen gegenüber, die sich im thematischen Feld zwischen Migration und Weltreisen, aber auch zwischen Altenheim und Debilenheim befinden.
Philipp Weiss wagt mit seinem Roman, der sich über fünf Bände und tausend Seiten erstreckt, den Versuch eines Gesamtkunstwerks. Der Roman erscheint bei Suhrkamp im Schuber, die einzelnen Romanbände kommen alle in unterschiedlichem Layout daher und auch jeweils mit einem fiktiven Autor, nämlich dem Protagonisten des Bandes. Alle fünf Protagonisten sind verbunden über verwandtschaftliche oder freundschaftliche Beziehungen. Jedoch wird bei der Lesung kaum klar, welcher der Protagonisten gerade spricht, was eventuell dadurch zu erklären ist, dass alle fünf Hauptfiguren einen düsteren Sprechgestus haben. Sie sind alle gefangen in einer Situation, die sie nicht bewältigen können. Allein Akio, ein japanisches Kind, das beim Tsunami von Fukushima davongespült wird, bleibt auf seiner abenteuerlichen Reise positiv. Die Reise ist ein zentrales Thema, jedoch scheint es, als würden die Figuren zwar den Ort wechseln, aber nicht aus ihrem geistigen Gefängnis ausbrechen können. Sie verzweifeln an der Welt und an sich selbst und bleiben unglücklich. Beim Gespräch mit den Salzburger Studenten am nächsten Tag bestätigt Weiss, dass er den Zugang zur Literatur ähnlich wie in der Romantik ganzheitlich sieht. Die Kunst umfasse alles und er versuche ein Bild der Ganzheitlichkeit, der Verbundenheit zu zeichnen. Er rettet sich jedoch durch Fakten, einen Rettungsring, den er nicht nötig hätte, denn die spannendsten Antworten gibt er unvorbereitet.
Tags darauf liest Katharina Braschel ihren Text Das gute Bild, mit dem sie den Förderungspreis von Rauris gewonnen hat. Zwei Paare wohnen gegenüber, kennen sich jedoch kaum; Empathie, erste Eindrücke und der trügerische Schein sind die treibenden Elemente des Textes. Braschel schaut mit zynischem Blick auf gut situierte, respektable Mitbürger, die keinen Blick für miserable Lebensumstände anderer übrighaben.
Eines der spannendsten Rauris–Segmente sind die Gespräche zwischen Autoren und Studierenden. Die Fragen von Studierenden zeigen überraschende Zugänge zu den Texten und liefern selbst den Autoren manchmal neue Informationen: Es fragt sich allerdings auch, ob Susanne Fritz wirklich erfahren musste, dass in ihrem Buch Wie kommt der Krieg ins Kind 380 Fragen gestellt werden.
Miteinander reden, Gespräche, Diskussionen – das sind die spannenden Formate bei den Rauriser Literaturtagen, weil sie nicht wie eine „normale“ Lesung ablaufen. Nach den Gesprächen ist man beinahe gespannter auf ein Buch als nach einer Lesung. Allen, die an Vormittagen Zeit haben, kann ich nur ans Herz legen, eines der Gespräche mitzuverfolgen. Der Blick von außerhalb, der manchmal kritischer sein kann als jener der Intendanten, fordert die Autoren und entlockt ihnen authentische Antworten. Eine ebenso erfrischende Abwechslung ist dieses Mal der Lyrikvormittag, ein Lichtblick zwischen den Standard-Prosa-Lesungsformaten. Simone Lappert, eine junge Schweizerin, überzeugt durch ihren lebendigen Zugang zu Sprache – ihr Buch erscheint im Herbst. Da fragt man sich natürlich schon, wie schlecht so ein Verlag organisiert ist, wenn er zu einer so wichtigen Sache wie Rauris kein Buch zur Hand hat.
Bücher habe ich zwei aus Rauris mitgebracht: Einerseits steht das Siegerbuch Am Weltenrand sitzen die Menschen und Lachen von Weiss in meinem Regal, weil ich diesen Versuch eines Gesamtkunstwerks interessant umgesetzt sehe. Dass die Ausführung eines Gedankens sich zu einem Projekt über sechs Jahre zieht, und dann auch liebevoll gestaltet wird, finde ich bewundernswert. Das zweite Buch, das ich mitgenommen habe, ist Über dem Himmel unter der Erde, ein ins Deutsche übersetzter Lyrikband von dem slowenischen Autor Aleš Šteger. Der Roman Königin der Berge von Daniel Wisser, der den Österreichischen Buchpreis 2018 gewonnen hat, hat es in Rauris nicht in den Einkaufskorb geschafft, was ich – wieder in Salzburg angekommen – bereue. Den muss ich mir vielleicht noch in der Buchhandlung holen – leider halt nicht signiert.
Generell laufen die Rauriser Literaturtage 2019 ohne Schwierigkeiten und Skandale ab. Die braucht es aber auch nicht. Wer eine knappe Woche in Rauris verbringt, wird mit neuen Denkweisen konfrontiert und gedanklich in verschiedene Länder und Situationen entführt. Es ist als Besucher, der alle fünf Tage dort ist, zwar wahnsinnig anstrengend, sich immer neu auf einen Text und Autor einzustellen, aber am Schluss bleibt doch viel Gutes. Auch wenn einem unmöglich jeder Text und Zugang gefallen kann, kann man die aufgeladene Atmosphäre bei den Lesungen spüren. Es macht Freude, mit den Autoren nach ihren Lesungen zu sprechen und gemeinsam Campari Orange zu trinken. Alle Menschen, mit denen ich dort gesprochen habe, waren sehr aufgeschlossen und wirkten erfreut, wenn man die eigene Scheu überwinden konnte, um mit ihnen zu sprechen. Als Besucher kann man sich in Rauris wie ein U-Boot fühlen, das in der bodenlosen See der Literatur untertaucht und auf der Reise mehr als nur eine Entdeckung macht.